von Arnd Wesemann
Jenseits des Safari-Wagens
Tiere gucken geht in Namibia auch anders:
Krokodile mit dem Boot verfolgen, im Flugzeug
über Elefantenherden und zu Fuß mit singenden San
 Beim Blick aus dem Flugzeug legt sich die Dünenlandschaft wie ein Filmbild vor das Seitenfenster. |
Zu Fuß durch die glühende Savanne hinter den Fußstapfen von Elefanten her, nur einen bewaffneten Spurenleser an der Seite: Wer diesen Mut hat, heißt es, sei ein wahrer Safari-Held. Hinter jedem Busch ein hungriger Löwe. Jedes Knacken im trockenen, kaum mannshohen Geäst erzeugt mehr Testosteron, als mit zwanzig Hobbyfotografen auf einem fahrenden Hochstand pünktlich zum Sundowner einer Herde Elefanten gegenüberzustehen.
250 000 Elefanten soll es allein rund um den Caprivi-Zipfel im äußersten Nordosten Namibias geben. Gut für Safari-Touristen. Aber die gewaltigen Herden bedrohen die Dörfer, auch wenn deren
Bewohner sich mit relativ einfachen Mitteln gegen die Elefanten schützen können: frischen Elefanten-Dung mit scharfem Chili anrühren und in Zwiebelsäckchen an die Holzzäune der Siedlungen hängen. Die Elefanten mit ihren feinen Nasen machen einen Riesenbogen
um die olfaktorische Beleidigung und verschwinden in der gewaltigen Landschaft aus Wasserläufen, Sümpfen und Trockenebenen am fruchtbaren Grenzstreifen zwischen Botswana, Angola und
Sambia.
Genau hier gibt es mindestens drei Safariformen, die weit abenteuerlicher sind, als im Toyota von einer Luxuslodge zur anderen zu fahren und zu Fuß wohlbehütet einem bewaffneten Ranger hinterherzulaufen.
Die Krokodil-Safari
Die Krokodil-Safari ist tatsächlich der letzte Schrei. „Erzähl aber bloß nicht, dass wir Krokodil-Safaris anbieten“, sagtWillem de Wet, „viel zu gefährlich.“ Natürlich nicht für ihn, den Namibier mit weißem Bart, der keine Sekunde zögert, sobald etwas nach Abenteuer riecht.
Wir sind amUfer des Kwando-Flusses im Nordosten in einer kleinen Ortschaft namens Namushasha (zu Deutsch: „sehr viel Wasser“). Das offene Stahlboot mit seinem 85-PS-Außenborder wird beladen, vor allem mit „Peaceful Sleep“, einem in dieser Flussregion unerlässlichen Aerosol gegen Mücken. Das Wasser des Kwando mäandert pechschwarz
durch das Schilf. Papyrusstauden, Wasserlilien, ab und zu ein Kräuseln. Nichts deutet auf die starke Strömung hin.
Mit an Bord sind Gordon Vorster, ein stämmiger Mann, der die Sache mit dem Chili-Elefanten-Dung entdeckt hat, Arno Gröbler, der Touristen sonst mit einem Original-Monster-Truck aus dem
Film „Mad Max“ durch die Gegend schaukelt, und Willem de Wet, Abenteurer und Herr über sechs Lodges in Namibia. Es ist neun Uhr abends und stockfinster. Arno am Steuer treibt das Boot
in scharfen Kurven flussaufwärts. Gordon verteilt die Drinks.
Willem liegt im Bug, den Suchscheinwerfer in den Händen. In dessen Licht sollen die Augen der Krokodile reflektieren. Still wie ein Ast lauern sie im Wasser. „79 Krokodile auf zwanzig Kilometern haben wir zuletzt gezählt“, flüstert Arno. Tatsächlich funkeln gleich zwei Augen im Wasser. Arno
gibt Gas. In Höchstgeschwindigkeit richtet das Boot sich auf und heult durch die Nacht – es war kein Krokodil, sondern ein Flusspferd. Die attackieren gerne mal Boote und werfen sie einfach um. Sie sind also genauso wenig zu unterschätzen wie störanfällige Elefanten. Das Herz pocht, man hört es, der Motor ist jetzt still. Wir lassen uns flussabwärts treiben. Kein weiteres Paar Augen kommt in Sicht. Wir lauschen in die Nacht. Zum Gesang der Glockenfrösche reicht Gordon Whisky. Arno, der
Wildkenner, deutet das wohlig stöhnende Gebrüll von Löwen, das keifende Bellen von Hyänen, das Wiehern von Flusspferden im Schilf. Es ist schwer auszumachen, in welcher Entfernung sich die
Tiere zu uns befinden, der Fluss verstärkt ihre Geräusche. Ein Meer aus Sternen liegt über uns, darin das Kreuz des Südens.
Die Flug-Safari Die Flugsafari ist nach dem Konzert im nächtlichen Kwando-Fluss das ohrenbetäubende Kontrastprogramm. Es gibt fast keinen Ort in Namibia ohne ein Flugfeld.
Die Cessna wird per Handpumpe vom Pick-up aus betankt.Willem de Wet sitzt rittlings auf dem Flügel, den Tankschlauch zwischen den Beinen. Er prüft das Gerät mit aller erdenklichen Sorgfalt,
bevor der Propeller startet, die Maschine über die staubige Piste schwebt und sich mit einem zentimetersicheren Gefühl für die Baumhöhe über Schirmakazien und Baobabs ähnlich kamikazehaft auf die Landschaft stürzt wie die schwarzen Trappenvögel im Buschland unter uns. Die hühnerähnlichen Senkrechtstarter steigen meterhoch auf und fallen ohne einen weiteren Flügelschlag kreischend zu Boden. Ähnlich stürzt sich dieCessna gegen die Savanne.Mit schrägen
Tragflächen legt sich die Flusslandschaft wie ein Filmbild vor das Seitenfenster.
Elefantenfamilien steigen in Bruchteilen von Sekunden aus dem Fluss, eine Antilopenherde fällt rücklings aus dem Rahmen, zwei Straußenvögel entweichen dem Blick schneller, als sie selber flüchten könnten.
|
Die Safari mit den San
Ziel des wilden Ritts sind die Ju/’hoansi, ein Clan des Volkes der San. Sie leben südlich des Khaudum Nationalparks an der Grenze zu Botswana, mitten zwischen afrikanischen Wildhunden, Kudus und Oryx-Antilopen. Mit diesen Menschen in den Busch zu gehen, ist etwas ganz anderes als eine schnöde Safari zu Fuß. Hier schützt einen kein Gewehr, allenfalls ein Lied, mit dem der Clan samt Kindern, Großeltern und Müttern voranschreitet und den Eindruck macht, weder Leoparden noch Löwen zu fürchten. Stattdessen flaniert man mit ihnen durch ihr zehntausend Jahre altes Wissen. In perlenbesticktes Leder der von ihnen erlegten Tiere gekleidet, gehen sie voran
durch ihre Busch-Apotheke, hier von einer Sal-Weide ein Ästchen brechend, das gegen Kopfschmerz hilft, dort die Hoodia-Kakteen pflückend, die traditionell bei der Jagd als Appetitzügler eingesetzt
wurden. Die Pharmaindustrie gewinnt daraus ein Schlankheitsmittel. Seit 2003 in einem Gerichtsverfahren den San eine Beteiligung an den daraus resultierenden Erlösen zugestanden wurde, hilft ihnen das über beutelose Zeiten hinweg. Links geht es in die Abteilung Waffen
und Munition: Pfeilgras, daneben steht eine Akazie, deren Saft auf einen Giraffenhalswirbel geträufelt und mit Spucke und bestimmten Insektenlarven gemischt ein tödliches Pfeilgift ergibt.
Xushe heißt einer der älteren Männer, dessen linker Arm amputiert ist. Um zu beweisen, dass er die Frau wert war, in die er sich verliebt hatte, sollte er allein ein Tier erlegen. Er erzählt, wie er mit dem bereits gespannten Pfeil stolperte und sich in den eigenen Arm schoss. Das Gift wirkt langsam, ein getroffenes Tier kann noch Stunden weiterlaufen, bis es stirbt. Xushe aber hatte Glück im Unglück.
wieder auftaucht. Kohlrabiweiß ist die Knolle und wird auf sauber geschnittenem Gras wie auf einer Tischdecke geschält und geteilt. Die San kennen keinen Privatbesitz und sie mögen augenscheinlich Spaß. Mit geckenhaft verdrehten Augen und einem närrisch gespielten Verzücken presst der Clan-Älteste den Saft wie aus einem Schwamm und träufelt ihn unter großem Gelächter in den Mund seiner Frau.
Im lebenden Museum
Es ist Nacht im Khaudum Nationalpark, einem der exklusivsten Naturreservate überhaupt, denn nur wenige Touristen wagen sich hierher. Man ist allein auf 3850 Quadratkilometern. Es gibt zwölf
künstlich angelegte Wasserlöcher und zwei natürliche Quellen und jede Menge wilde Tiere. Das Camp wird neben einem von Holzzaun umgebenen Dorf der San aufgeschlagen. Ihr Land ist so trocken, dass jeder Tropfen Wasser von Mensch und Tier gleichermaßen umkämpft wird.
Die mobilen Touristen-Camps mit ihren künstlichen Wasserreservoirs locken Elefanten und Hyänen an. Im Lodern des Lagerfeuers tanzen nebenan die San, verwandeln sich –wie Schamanen in Trance – in ihreGegner und Beutekonkurrenten, tanzen und schreien den Löwen, die Hyäne, den Elefanten heraus. Aus ihren Kehlen klingen die Laute der Nacht, die wir schon am Ufer den Kwando-Flusses hörten: ein Wiehern, ein rhythmisch keifendes Gebell, ein stöhnend-stampfendes
Gebrüll. Die San selbst nennen sich manchmal ein „lebendes Museum“, weil sie immer noch ein so traditionelles Leben führen, während der Ring der Moderne um sie herum sich immer dichter
schließt. In manchen ihrer melancholischen Gesänge geht es um das Bedauern darüber, dass das uralte Wissen Afrikas gerade ausstirbt. Von den San bleiben oft nur noch die Alten und junge Frauen mit ihren Kleinkindern in den Dörfern. Die Männer dagegen ziehen fort in die Städte, den Touristen und ihrem sagenhaften Luxus hinterher.



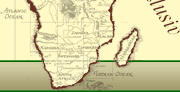












 Bericht drucken
Bericht drucken Download PDF
Download PDF












