Text & Fotos von Martenson Sten
Scheinbar grenzenloses Wasserlabyrinth
Mit dem Boot unterwegs im Vierländer-Eck zwischen Namibia, Botswana, Sambia und Zimbabwe
Kein Zweifel: Es ist Albert, der hünenhafte schwarze Namibier, der unser katamaranähnliches Aluminiumboot durch das Gewirr der Zu- und Abflüsse des Sambesi steuert. Aber zu erkennen ist er nicht. Nur schemenhaft, einer Statue gleich, deren linke Hand das Steuerrad umklammert, hebt er sich gegen den nachtschwarzen Himmel ab. Weiß der Teufel, woher Albert weiß, wann er nach links und wann nach rechts abbiegen muss. Unsere Touristen-Augen sehen kaum, wo Wasser ist und wo die mannshohen Papyrusbüschel das Ufer markieren. Urplötzlich tauchen aus der Finsternis die Lichter der Impalila-Lodge in der äußersten Nordostecke Namibias auf. Wir sind am Ziel.
Stunden zuvor hatte uns Albert noch unter dem wuchtigen, knapp tausendjährigen Baobab-Baum den Lunch serviert und dabei aufgezählt, womit man hier seine Zeit vertreiben kann: Wir könnten fischen, im Pool planschen, die Insel zu Fuß erkunden oder mit dem Boot auf Safari gehen. Als die Sturzbäche des nachmittäglichen Tropengusses versiegt waren, brachen wir mit Albert Richtung Chobe-Nationalpark auf, um Afrika aus der Bootsperspektive zu erleben.
Und je nachdem, wie Albert mit dem Boot kreuzt, fällt der Blick auf Namibia, auf Botswana, oder auch auf Sambia und sogar Zimbabwe.
Der sogenannte Caprivi-Zipfel, der dieses spektakuläre Vierländer-Erlebnis möglich macht, ist ein kolonialgeschichtliches Unikum. Auf keiner Landkarte hat es ordentlich Platz. Wie ein Speer, sagen die einen, wie ein Wurmfortsatz, die anderen, ragt er aus der einstigen deutschen Südwest-Kolonie in die früheren kolonialen Gefilde der Briten hinein. Als auch das deutsche Kaiserreich gegen Ende des 19. Jahrhunderts Geschmack an territorialen Eroberungen fand, gab es auf dem afrikanischen Kontinent nicht mehr viel zu verteilen. In Afrikas Südwesten fiel für die Deutschen aber noch etwas ab. Nur fehlte ein Zugang zum Indischen Ozean. Die kolonialsatten Briten waren 1890 bereit, den Deutschen im Tausch gegen Sansibar eine Landzunge zum Sambesi hin zu überlassen. Und großzügig steuerten sie die Nordseeinsel Helgoland als Morgengabe bei. Das nährt natürlich den Verdacht, dass ihnen der Landstreifen zwischen ihren Kolonien Nordrhodesien und Betschuanaland ohnehin nicht viel wert war. Fortan hieß er Caprivi-Zipfel, weil der amtierende Reichskanzler in Berlin auf den Namen Leo von Caprivi hörte. Früher war dieser Teil Namibias, fern der Regierungszentrale in Windhuk, eine der wildreichsten Regionen des Landes. Aber die Jagdlust weißer Touristen ließ die Wildbestände in vielen Jahrzehnten drastisch schrumpfen. Inzwischen haben die Namibier erkannt, dass ihr Wild ein unschätzbares Kapital ist und Wildern sich nicht lohnt. Bleiben Fauna und Flora intakt, kommen die Touristen. Sie wollen in der ihnen fremden Umgebung aber auch behütet und-versorgt sein. Das schafft viele Arbeitsplätze auf den Lodges und in den Camps. Und die Bevölkerung wird auch in die Natur- und Umweltschutzprojekte eingebunden. Nahe der Lianshulu-Lodge am Kwando haben die Dorfbewohner der Region ein traditionelles Dorf errichtet. Besucher erfahren in Lizauli, wie die „Caprivis" ihr Getreide lagern und die Mausefallen funktionieren. Traditionelle Tänze zu mitreißenden Trommelklängen geben Einblick in das Dorfleben und kunstfertige Flecht- und Schnitzarbeiten warten auf Käufer, um ein wenig Geld in die Dorfkasse zu bekommen.
Der Erfolg dieser Politik ist nicht zu übersehen. Ob am Sambesi, Kwando oder Linyanti: Die Zahl der Flusspferde und Elefanten, der Krokodile und Antilopen ist wieder in Höhen geklettert, die den Gästen aus Europa oder Amerika fast garantieren, sie auf freier Wildbahn zu Gesicht zu bekommen. Tags darauf pirschen wir uns mit Simon im geländegängigen Wagen durch den Busch. Längs des Kwando-Ufers streunt ein einsamer Elefantenbulle. Zu Simons Verwunderung will er sich nicht an die gängigen „Spielregeln" halten. Er flattert nicht nur erregt mit seinen riesigen Ohren und trompetet unüberhörbar Warnungen an uns Eindringlinge, sondern nimmt umgehend Kurs auf unser Fahrzeug. Ihm steht unübersehbar der Sinn auf Attacke. Simon fingert leicht nervös am Zündschlüssel. Beim ersten Startversuch ohne Erfolg. Endlich springt der Motor an. Der Wagen schleudert über die Sandpiste. Der Bulle gibt erst nach gut hundert Metern auf. Wir atmen erleichtert durch. Später verfolgen wir aus sicherer Distanz, wie riesige Elefantenherden im Kwando übermütige Wasserspiele veranstalten. Am nächsten Morgen wartet Bevan, einer der schwarzen Guides, zu gnadenlos früher Stunde auf seine noch verschlafenen Gäste. Auf idyllischen Wasserpfaden tuckern wir behutsam um viele Flusspferd-Familien herum, deren Glubschaugen uns wachsam beobachten. Bevan kennt natürlich genügend Geschichten, in denen die so ungeschlacht wirkenden Hippos urplötzlich unter den leicht gebauten Booten auftauchen und diese zu kentern drohen. Gewiss, Flusspferde sind auf pflanzliche Nahrung eingeschworen, aber wenn sie sich bedroht fühlen, greifen sie auch Menschen an. Am Ufer grasen friedlich die selten gewordenen Letchi-Antilopen, die von der Natur mit längeren Hinterläufen und damit besonders gut für sumpfige Flussniederungen ausgestattet worden sind. Am sandigen Ufer döst hier und da ein Krokodil und genießt die aufkommende Wärme des afrikanischen Tages. Vögel aller Arten und Farben beleben die Szenerie. Kingfisher haben Spaß daran, das Boot im Flug zu begleiten. Am Uferrand stolzieren Reiher, Schwarzstörche und auch Sekretärvögel. Fischadler suchen Beute. Afrikanische Guides sind darauf geeicht, vor allem britischen und amerikanischen Touristen jede der im Caprivi-Zipfel beheimateten 400 Vogelarten präzise zu bestimmen, notfalls nach einem Blick in das einschlägige Handbuch. Auf jeder Lodge und in jedem Camp findet der vogelhungrige Besucher mehrseitige Strichlisten, auf denen abgehakt werden kann, welches Flugobjekt man gesehen hat. Uns genügen die vertrauten „Heimatklänge" der Schwalben, die immer wieder in Riesenschwärmen laut tschilpend aus dem Ufergebüsch aufsteigen. Und Bevan belehrt uns diensteifrig: „Das sind Schwalben. Die kommen zu uns, wenn in Europa Winter ist."
| Seite 1/2 | Seite vor |



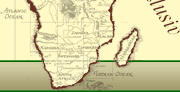












 Bericht drucken
Bericht drucken Download PDF
Download PDF











